Es geht alles ein bisschen von oben herab
Gespräch mit Gerd Poppe über die politische Kultur in der ehemaligen DDR, über die Rolle der Bürgerbewegung und ihr Verhältnis zum Parlamentarismus.
Frage: Ein halbes Jahr nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik hat das, was Willy Brandt einmal als "Zusammenwachsen" bezeichnet hat, kaum begonnen. Das liegt an ökonomischen Gegensätzen, an dem drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruch in der ehemaligen DDR und den unterschiedlichen Lebenschancen, aber es hat wohl auch viel damit zu tun, dass es über 40 Jahre in Deutschland zwei getrennte Staaten gab, die sich unterschiedlich entwickelt haben. Was wird aus der politischen Kultur der ehemaligen DDR übrigbleiben? Was wird davon in die größere Bundesrepublik eingehen?
Poppe: Eine politische Kultur der alten DDR insgesamt gibt es wohl kaum. Es hat dort - wie schon oft beschrieben - eine Art Nischengesellschaft gegeben, die dadurch gekennzeichnet war, dass sich große Teile der Gesellschaft aus der Politik herausgehalten haben. Es gab ohnehin nur zwei Möglichkeiten: entweder sich mit dem System zu arrangieren und dann entsprechend dem zentralistischen und hierarchischen Prinzip ein Rädchen im Gesamtmechanismus zu werden oder aber sich auf unterschiedliche Weise zu wehren, einmal, indem man die Nischen suchte oder - und das betrifft eine winzige Minderheit - indem man Widerstand leistete. Diese beiden, einerseits sehr große und andererseits sehr kleine, Gruppen haben ein ganz unterschiedliches Gepräge. Das, was sie eint, ist vielleicht der tatsächlich andere Verlauf der Geschichte und die stärkere Ausrichtung nach Osten. Es kommen Sprachunterschiede hinzu und andere Verhaltensweisen, denen, im Vergleich zur alten Bundesrepublik ein Mangel an Selbstbewusstsein eigen ist. Sich in irgendeiner Form selbst zu organisieren, war außerordentlich schwierig und ist nur wenigen - zunehmend in den achtziger Jahren - geglückt. Bis dahin gab es nur ganz vereinzelte Oppositionelle, die auch in der Öffentlichkeit deutlich machen konnten, dass sie an einer Änderung des Systems interessiert sind und die auch entsprechende Vorschläge machen konnten. Die ganze Gesellschaft hat eine spezifische Passivität gekennzeichnet, obwohl sie, von außen betrachtet, politisiert wirkte. In den Schulen, in den Betrieben wurde unaufhörlich von politischen Dingen geredet: Die Leute wurden zu Versammlungen geholt, sie mussten Erklärungen unterschreiben und so weiter. Trotzdem gab es paradoxerweise eine große Enthaltsamkeit gegenüber der Politik. Das ist keine gute Voraussetzung für die Entwicklung einer politischen Kultur. Das ist Neuland, und ich denke, dass viel von den Strukturen der alten Bundesrepublik übernommen werden wird. Diejenigen, die schon länger Politik betreiben und sich seit 1968 auch als Opposition verstehen, haben durchaus eine eigene politische Kultur entwickelt, die weitgehend von der in der alten Bundesrepublik abweicht. Das hat mit den starken Beziehungen in Richtung Mittel- und Osteuropa zu tun. In den alten Bundesländern gab es eine starke Anbindung an Westeuropa. Europa wurde dort im Grund immer mit Westeuropa gleichgesetzt. Das ist auch jetzt noch nicht wesentlich anders, vielleicht ergänzt um die ehemalige DDR.
Wir hatten dagegen immer Kontakt in Richtung Osten. Wir haben unsere politische Arbeit, unsere politische Kultur weitgehend an dem orientiert, was an Impulsen aus dem Osten kam. Ich erinnere an die Versuche der DDR-Opposition, Kontakt mit der Charta '77, mit der Solidarność und mit Dissidenten aus der Sowjetunion aufzunehmen, sich öffentlich gemeinsam durch Erklärungen und Unterschriftenaktionen zu präsentieren. Diese Nähe besteht bis heute.
Wir haben die wichtige Aufgabe mit in die neue Bundesrepublik hinübergenommen, eine Brückenfunktion von Deutschland in Richtung Osten wahrzunehmen - auch im Sinne der viel beschworenen europäischen Integration. Ich glaube, dass niemand das so gut leisten kann wie die Leute, die bisher in der ehemaligen DDR politisch tätig waren.
Führt diese andere politische Tradition auch zu einem anderen Politikverständnis?
Die direkte Einbeziehung der Bürger in Politik, abseits von Parteistrukturen, ist eine der zentralen Konsequenz aus der sogenannten friedlichen Revolution. Die Gruppen des Herbstes 1989 haben ja eine Vorgeschichte. Sie ist geprägt durch das, was sich in Osteuropa ereignete, etwa 1968 in Prag – ein wichtiges Ereignis -, dann aber auch durch die Friedensbewegung, die zunächst im Westen entstand und in der DDR eine ganz eigene Ausformung erfuhr. Zunächst einmal wurden Aktionsformen und Vorstellungen der bundesdeutschen Friedensbewegung aufgegriffen. In sehr kurzer Zeit kam es dann aber zu einer eigenen Prägung, insbesondere aufgrund der hier von allen empfundenen Militarisierungstendenz innerhalb der Gesellschaft. Es kam zu einer Mischung von christlichen und linken Traditionen in der Friedensbewegung und der dann entstehenden Ökologie- und Menschenrechtsbewegung.
Diese spezifische Mischung hat eine ganz besondere Art von Opposition geschaffen, die sich von denen in anderen osteuropäischen Ländern unterscheidet. Ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie die Menschen im Herbst 1989 auf die Straßen gingen und sich anschließend um einen Konsens an "Runden Tischen" bemühten, auf diese Entwicklung zurückzuführen ist.
Sie unterscheidet sich deutlich von all dem, was etwa an Protestbewegungen in der alten Bundesrepublik lief. Ich glaube also schon, dass wir in dieser Hinsicht so etwas wie eine politische Kultur zu verteidigen haben. Die "Runden Tische" vom Herbst 1989 bis zum Frühjahr 1990 waren immer bemüht, in dieser Krisensituation zwischen den ganz verschiedenen politisch relevanten Gruppierungen und Parteien einen Konsens zu finden. Es gab hier kaum Kampfabstimmungen, ganz wenig Parteiauseinandersetzungen. Die Vertreter an den "Runden Tischen" haben es im allgemeinen geschafft, sich in den entscheidenden Fragen so weit näher zu kommen, dass ein gemeinsamer Beschluss möglich wurde. Diese Art miteinander umzugehen, die wohl auch auf die besondere Geschichte der Opposition in der DDR zurückzuführen ist, habe ich bisher noch nicht wiedergefunden, auch bei den Grünen nicht. Dabei würde es sich lohnen, die Erfahrungen, die wir sowohl im Umgang miteinander als auch im Umgang mit den jeweiligen Themen gemacht haben, unbedingt zu bewahren. Demokratie sollte für uns nicht nur die klassische parlamentarische Demokratie mit einer Handvoll Parteien sein, die ihrerseits ähnliche Strukturen haben, wie wir sie von früher auch kennen: die Parteispitze dominiert und nur bei Wahlen ist die direkte Beeinflussung durch den Bürger möglich. Im Unterschied dazu ist die Politik der Bürgerbewegung darauf angelegt, ständig Kontakt zu den Menschen zu haben, mit ihnen zu sprechen und sich auch einer Auseinandersetzung zu stellen.
Welche Bedeutung haben denn zur Zeit die Bürgerbewegungen noch in der ehemaligen DDR? Vom Westen her betrachtet hat man den Eindruck, dass sie als Politikmodell sozusagen abgewählt worden sind. Auch aus der Berichterstattung sind sie weitgehend verschwunden.
Das Neue und Exotische für den Westen hat die Medien anfangs sehr gereizt. Inzwischen ist man zum Alltag übergegangen. Die ganze Art der Vereinigung hat dazu geführt, dass nahezu alle Strukturen der alten Bundesrepublik im Osten übernommen wurden. Das ist von östlicher Seite nicht immer freiwillig geschehen, aber wirtschaftliche Stärke und Dominanz führten dazu. Dagegen war einfach kein Kraut gewachsen. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Bürger der Ex-DDR diese andere Form von Politik, die ihm mehr oder weniger übergestülpt wurde, inzwischen vollständig verinnerlicht hätte und in allen Bereichen akzeptiert würde. Es ist festzustellen, dass nach wie vor Selbsthilfegruppen und Bürgerinitiativen, dass Mieterschutzvereine entstehen.
Demonstrationen werden vielleicht nicht mehr so entscheidend sein wie früher, aber sie bleiben eine Möglichkeit, politische Differenzen auszutragen. Aktionen oder Demonstrationen können eine Gesellschaft, die so festgefügt und stabil ist wie die der Bundesrepublik, nicht entscheidend ändern. Aber diese Art von Öffentlichkeitsarbeit wird auf jeden Fall bewusstseinsbildend bleiben. Die Art des Beitritts der DDR nach 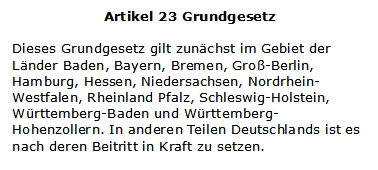 Artikel 23 Grundgesetz hat uns gezwungen, uns sehr stark auf die hiesigen politischen Bedingungen einzustellen. Wir verschließen uns dem auch nicht, sondern bemühen uns, sie zu nutzen.
Artikel 23 Grundgesetz hat uns gezwungen, uns sehr stark auf die hiesigen politischen Bedingungen einzustellen. Wir verschließen uns dem auch nicht, sondern bemühen uns, sie zu nutzen.
Dabei ist uns völlig klar, dass wir eine Minderheit bleiben werden und nicht damit rechnen können, Mehrheiten in der Gesellschaft zu erreichen. Unsere Politik ist auch nicht darauf angelegt, unbedingt mehrheitsfähig zu sein. Sie ist auch schon in der alten DDR eine Politik gewesen, die von Minderheiten und zum Teil für Minderheiten entwickelt wurde. Da gibt es jetzt nur eine Schwerpunktverlagerung. Unsere Aufgaben - wie wir sie früher gesehen haben - waren, uns für die Garantie der Menschenrechte einzusetzen, für die Entwicklung von Demokratie, in der Öffentlichkeit ein Problembewusstsein zum Beispiel für die drohende Umweltkatastrophe oder für Menschenrechtsverletzungen zu schaffen. Dafür hat sich nur selten eine Mehrheit interessiert.
Die Protestbewegung, die dann schließlich zur Bildung der verschiedenen Bürgerbewegungen führte, bestand im Grunde aus einer so verschwindend kleinen Zahl von Menschen, dass es uns regelrecht erstaunt hat, wie viele sich dann anschlossen. Aber es war und blieb eine Minderheit, und wir haben keine andere Möglichkeit als diese Rolle anzunehmen. Es geht darum, Mehrheiten sensibel zu machen, anzustoßen, in Bewegung zu setzen.
Sie sind bei der Bundestagswahl im Dezember 1990 nur knapp in den Bundestag gekommen. Was kann man mit diesem eher schwachen parlamentarischen Standbein bewirken?
Ganz so knapp war es ja nicht. Für die Zukunft stellt sich die Frage, ob es gelingt, Bürgerbewegung und Grüne zusammenzubringen und auch organisatorisch miteinander zu verknüpfen. Es ist mir zu spekulativ, darüber schon jetzt detaillierte Vorstellungen zu entwickeln. Eins wird aber auf jeden Fall passieren: Die verschiedenen Bürgerbewegungen werden sich organisatorisch zusammenschließen. Die Gespräche darüber laufen bereits seit Monaten. Und dazu gehören auf jeden Fall auch die Ost-Grünen, die zurückhaltend sind, sich allzu sehr mit den West-Grünen einzulassen, obwohl sie den formellen Zusammenschluss teilweise vollzogen haben. Das alles wird zu klären sein, wenn es um das politische Überleben auch in Parlamenten geht. Die Auffassungen darüber sind sehr unterschiedlich. Es gibt eine Reihe von Leuten in den Bürgerbewegungen, die sagen, wir müssten uns auf die außerparlamentarische Arbeit beschränken. Ein anderer, zur Zeit größerer Teil meint, wir müssten beides machen: die Basisarbeit fortsetzen sowie die parlamentarischen Möglichkeiten nutzen. Ein Weg für die Zukunft könnte die Zusammenarbeit zwischen Alternativer Liste, DDR-Bürgerbewegungen und Grünen sein - wie es im Berliner Abgeordnetenhaus geschieht. Eine andere Möglichkeit wäre es, eine parteiähnliche Struktur zu schaffen, wobei die Frage auftaucht, inwieweit die Bürgerbewegung dann noch Bürgerbewegung bleibt. Das ist eine verzwickte Frage. Gegenwärtig haben wir kaum Zeit, daran zu denken, weil es erst einmal um das politische Überleben geht. In den neuen Bundesländern gibt es eine erhebliche Fluktuation: Die Bürgerbewegungen sind kleiner geworden und haben sich stärker differenziert. Viele Leute sind zu politischen Parteien abgewandert. Ich meine, dass die neuen Bundesländer - angesichts der Probleme, die sie jetzt haben - die Bürgerbewegungen aber noch eine Weile brauchen.
Die sozialen Probleme der Menschen in den neuen Bundesländern sind so stark, dass sie der Strukturen bedürfen, um das wirkungsvoll vermitteln zu können. Dabei können ihnen, neben den Gewerkschaften, die Gruppen der Bürgerbewegung am besten helfen.
Sehen Sie eine Gefahr, dass die Bürgerbewegung zerfallen könnte, indem sich Teile in unterschiedliche Richtung entwickeln oder sich politischen Parteien anschließen?
Insgesamt sehe ich diese Gefahr nicht. Das politische Spektrum der Gruppen ist so breit, dass sehr unterschiedliche politische Ansichten in ihnen aufgehoben sind. Infolgedessen sind die Gruppen auch in der Lage, Kontakte zu den verschiedenen Parteien zu knüpfen. In der parlamentarischen Arbeit unterliegen sie, anders als die Parteien, keinerlei Fraktionszwang. Wir sind der Meinung, dass wir den Dissens ebenso deutlich machen sollten wie unsere gemeinsamen Vorstellungen. Wenn wir in bestimmten politischen Fragen nicht auf einen Nenner kommen, dann wird im Grunde auch der Dissens öffentlich ausgetragen. Auch das ist ein Bestandteil politischer Kultur, den wir pflegen: Anders als in den großen Parteien soll die Meinung der Minderheit nicht einfach verschwinden, wie das im Bundestag deutlich wird.
Ist das Konzept der Volkspartei noch zeitgemäß?
Wenn Volkspartei zum Beispiel Fraktionszwang bedeutet, dann nicht. Ich habe aber generell Schwierigkeiten mit dem Begriff Volkspartei. Mir liegen Parteien oder politische Bewegung mehr, die offen sind, die flexibel auf neue Situationen reagieren können und die nicht nur alle vier Jahre den unmittelbaren Kontakt zum Volk suchen. Das ist zwar nicht immer leicht umsetzbar, aber es bedarf auf jeden Fall anderer Strukturen, als die großen Parteien sie haben.
Der Fraktionszwang ist ein anderes gravierendes Problem. Wir bemühen uns in den Parlamenten, mit bestimmten Anträgen auch andere Parteien anzusprechen. Wir sind offen nach allen Seiten, wenn es um die vernünftige Behandlungen von Sachproblemen geht und haben keine ideologischen Vorbehalte. Wenn es bei den grundlegenden Fragen, bei den Überlebensproblemen - Bewahrung des Friedens, Garantie der Menschenrechte, Schutz der Umwelt - Lösungen geben soll, müssen sich möglichst alle Parteien und eine ganz breite Öffentlichkeit daran beteiligen. Gegenwärtig zeigen die großen Parteien aber nur wenig Aufnahmebereitschaft für Impulse aus dem Osten.
Da geht es uns wie der Mehrheit der Bevölkerung in der ehemaligen DDR, die auch nicht richtig gehört wird. Der ehemalige DDR-Bürger wird ein bisschen mitleidig angeschaut, man traut ihm gar nicht zu, dass er so etwas wie eine eigene politische Kultur haben könnte. Die zum. Teil schlimmen Erfahrungen, die er in vierzig Jahren gesammelt hat, und die Erfahrungen mit der Beseitigung der Diktatur werden nicht ernst genommen oder gar als ein Gewinn für die neue Bundesrepublik betrachtet. Gerade hier in Bonn hat man oft das Gefühl, dass die Vorstellung dominiert, es könne alles so bleiben, wie es war, es sei nur etwas dazugekommen. Daran glaube ich überhaupt nicht. Die 16 Millionen Menschen, die hinzugekommen sind, werden die politische Landschaft in der neuen Bundesrepublik entscheidend verändern. Man wird immer ungläubig angeschaut, wenn man die Meinung vertritt, das Ende der alten DDR bedeute gleichzeitig auch das Ende der alten Bundesrepublik. Dabei geht es nicht nur um die Hauptstadtfrage, sondern um die Einbeziehung des Ostens insgesamt. Wir wollen dazu beitragen, dass der Westen das Hinzukommen dieser 16 Millionen Menschen als Gewinn für das vereinigte Deutschland versteht und nicht als Belastung.
Sind angesichts des ökonomischen Zusammenbruchs in der ehemaligen DDR Themen wie Menschenrechte, Ökologie, Nord-Süd-Konflikt überhaupt politikfähig?
Gegenwärtig sind die Chancen dafür nicht sehr groß. Die Mehrheit der Menschen in der ehemaligen DDR ist ausschließlich damit beschäftigt, sich auf die neuen Bedingungen einzustellen. Da gibt es viele Dinge, mit denen wir uns früher überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Das betrifft zum Beispiel alles, was mit Geld zu tun hat. Das hat in der ehemaligen DDR keine hervorragende Rolle gespielt, weil alles - wenn auch auf niedrigen Niveau - in einer wohlgeordneten, erstarrten Struktur vorhanden war. Der einzelne musste kaum Initiative entfalten. Diesem Lernprozess sind nun viele ausgesetzt. Dazu kommen die großen wirtschaftlichen und die damit verbundenen sozialen Probleme. Sie überlagern zur Zeit sämtliche politischen Aktivitäten. Das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Solange die Arbeitslosigkeit sich in einem derartigen Ausmaß entwickelt, solange nicht ausreichend investiert wird, solange es also den versprochenen wirtschaftlichen Aufschwung nicht gibt, werden diese Themen für den DDR-Bürger wichtiger sein als Umweltkatastrophen oder Kriege.
Die meisten Arbeitnehmer in der ehemaligen DDR haben bei der Bundestagswahl im Dezember 1990 die CDU gewählt, wahrscheinlich in der Hoffnung auf eine Besserung der wirtschaftlichen Situation. Trotzdem scheinen sich Arbeitnehmer in der ehemaligen DDR kaum politisch zu engagieren, noch weniger als etwa in der Bundesrepublik. Ist das Konzept einer Arbeiterpartei noch zeitgemäß? Oder ist es sozusagen ein Auslaufmodell, das durch die Geschichte der DDR zusätzlich belastet wird?
Die Bezeichnung "Arbeiterpartei" im engeren Sinne wird allgemein Misstrauen erwecken. Sie ist schwer belastet, weil sich die SED immer als die Vertretung der Arbeiter und Bauern dargestellt hat. Wer also in bestimmten Sprachmustern versucht der Bevölkerung einzureden, die einzig legitime Vertretung von Arbeitern zu sein, wird zunächst einmal auf Skepsis oder Spott stoßen. Wenn es allerdings darum geht, in die großen Parteien oder Gruppierungen unmittelbare Arbeitnehmerinteressen einzubringen, dann hat das schon eine Chance, da die Sensibilität für die sozialen Fragen im Moment groß ist. Dass alles, was an alten Sprachschablonen hängt, sich schwer tut, zeigt die mühselige Entwicklung der Gewerkschaften. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass in der ersten Zeit nach der Wende der Versuch unternommen wurde, deren zentralistische Strukturen - mit einem dominierenden Dachverband - zu bewahren. Es wird eine Weile dauern, ehe von den Arbeitnehmern begriffen wird, dass sie ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen müssen, dass sie vor Ort die entscheidenden Weichen stellen müssen. Sie waren es ja bisher nicht gewohnt, sich selbst an der Basis unmittelbar für die eigenen Belange einzusetzen, sondern sie haben immer darauf gewartet, dass eine Struktur vorgegeben wurde, in die man sich einfügen konnte. Es ist immer noch so, dass sich für Funktionen, bei denen es um die Vertretung von Arbeitnehmerrechten geht, kaum Leute finden. Deshalb werden immer wieder Leute aus dem alten Apparat als Interessenvertreter in die neuen Gremien gewählt. Es wird noch eine Weile dauern, bis Selbstbewusstsein und Problembewusstsein so stark sind, dass die Leute mehrheitlich Eigeninitiative entwickeln.
In der alten Bundesrepublik gibt es eine Diskussion um die Frage, wie die Gewerkschaften stärker von unten her gefestigt, wie Meinungsbildungsprozesse von unten nach oben organisiert werden können. Haben derartige Ideen in der ehemaligen DDR überhaupt eine Chance?
Vielleicht indem Bürgerinitiativen, wie sie in letzter Zeit entstanden sind, versuchen, diese Probleme aufzugreifen. Ich glaube, dass sie besser in Stadtteilen oder Kommunen hineinwirken können als Verbände, die sich zunächst eine feste Struktur geben und von daher versuchen, nach unten zu wirken. Ich glaube, die Vielfalt ist sehr wesentlich, selbst wenn dabei einiges dilettantisch gemacht wird. Sie stärkt das Vertrauen in die eigenen Vorstellungen und die eigenen Anläufe, und ist fruchtbarer als eine organisatorische Verfestigung von Anfang an. Das ist deshalb so wichtig, weil in der DDR jede Aktivität von unten erstickt wurde und nur das gemacht werden konnte, was vorgegeben war. Wenn auch nur der Verdacht aufkommt, dass es in ähnlicher Weise weitergehen könnte, wird man die Arbeitnehmer nicht dazu gewinnen können, ihre eigenen Interessen unmittelbar wahrzunehmen. Es wird eine Resignation bestehen bleiben, die gerade in der jetzigen Zeit verheerende Auswirkungen haben könnte. Wenn die Menschen nicht aus ihrer Lethargie herauskommen, wird auch keine Investition helfen.
Könnte das bedeuten, dass die Gewerkschaften in Kauf nehmen müssten, zunächst einmal schlechter organisiert zu sein, damit dieser Entwicklungsprozess mehr Zeit hat?
Zumindest sollten sie Initiativen, die sich an der Basis entwickeln, ausdrücklich ermuntern und unterstützen. Das gilt aber nicht nur für die Gewerkschaften, das gilt für alle neu zu bildenden Strukturen in der ehemaligen DDR.
Die DDR war ein extrem zentralistischer Staat, in dem schließlich sogar der Föderalismus von oben eingeführt worden ist. Ehe sich die kommunalen Strukturen und Länderstrukturen eigenständig entwickeln konnten, war ihnen schon etliches vorgegeben, sind vollendete Tatsachen geschaffen worden. Wenn man die ehemalige DDR tatsächlich schnell auf das Lebensniveau des Westens bringen will, dann muss man jede Eigeninitiative stärken, muss den Föderalismus in seiner Gesamtheit stärken und müsste sogar Konsequenzen daraus für das Grundgesetz ziehen, so dass die Länder und Kommunen größere Vollmachten bekämen, als sie sie jetzt in der alten Bundesrepublik haben. Das gilt sinngemäß für alle Organisationen und Interessenverbände und eigentlich auch für die Parteien.
Könnten Lethargie und Politikmüdigkeit nicht auch umschlagen und dazu führen, dass es noch einmal so etwas wie eine Politisierung der Bevölkerung in der ehemaligen DDR gibt?
Eine neue Politisierung wird es zweifellos geben. Die Frage ist, ob sie in eine aktive Gestaltung der fünf neuen Länder einmündet oder ob sie sich in Protest einerseits und Lethargie andererseits ausdrückt.
Wie würden Sie das Verhältnis von Bürgerbewegung zu den Parteien und Gewerkschaften beschreiben?
In der ersten Zeit nach dem Umbruch im Herbst 1989 hat die "Einheitsgewerkschaft" der DDR versucht, sich ein anderes Image zu geben und sich als offen darzustellen für Kontakte mit den Bürgerbewegungen. Das hatte deshalb wenig Aussicht auf Erfolg, weil vielfach dieselben Leute auftraten, die jahrelang eine andere Politik gemacht hatten.
Seitdem haben sich zwischen den Bürgerbewegungen und den sich neu formierenden Gewerkschaften kaum Berührungspunkte ergeben. Das hat nichts mit Interessenlosigkeit zu tun, sondern mehr mit dem langjährigen Mangel an einer eigenständigen Gewerkschaftspolitik. Es hat früher schon Kontakte zu Einzelgewerkschaften aus der Bundesrepublik gegeben, so dass es bei den Bürgerbewegungen keine prinzipielle Abneigung gibt, sich mit gewerkschaftlichen Problemen zu befassen. Wir werden versuchen, die Gewerkschaftsarbeit von unserer Seite aus zu verstärken, Kontakte herzustellen und eine engere Zusammenarbeit zu erreichen. Ein Problem dabei ist, dass die Gewerkschaften die politische Lage bisher vielleicht etwas zu einseitig betrachtet haben und, von den unmittelbaren Interessen ausgehend, eher Detailprobleme herausgreifen - gleichgültig, ob das Arbeitszeit ist oder Arbeitslosigkeit. Der politische Ansatz der Bürgerbewegung geht hingegen mehr in die Breite und ist stärker an den globalen Themen interessiert.
Bei den Gewerkschaften in der Bundesrepublik wird neuerdings auch eine Verbreitung des Politikansatzes sichtbar: So gibt es zum Beispiel eine Kontaktaufnahme zwischen dem DGB und den Naturschutzverbänden. Sehen Sie darin einen fruchtbaren Ansatz?
Wenn auf der anderen Seite die Bürgerbewegungen sich stärker um Belange der Arbeitnehmer kümmern würden, fände ich das gut. Ebenso wichtig wäre, dass Streiks oder sonstige Arbeitskämpfe nicht nur vom unmittelbaren Interesse an Tarifpolitik geprägt wären, sondern auch den Zusammenhang etwa zu Umweltproblemen herstellen würden. Dabei könnten die Interessen von Bürgerbewegungen und Gewerkschaften zusammenlaufen. Wir sind dafür offen.
Voraussetzung ist allerdings, dass die Strukturen nicht hierarchisch entwickelt werden und damit der unmittelbare und direkte Kontakt zwischen der Basis von Gewerkschaften und Bürgerbewegungen gestört wird. Das ist aber praktisch gar nicht so einfach, wie es sich anhört.
Die Zusammenarbeit auch über Parteigrenzen hinweg gehört zum politischen Selbstverständnis der Bürgerbewegungen. Weiche Erfahrungen haben sie damit in Bonn gemacht?
Als wir hier angekommen sind, sind wir auch von den großen Parteien freundlich empfangen worden. Es wurde uns auf die Schulter geklopft und wir wurden dafür beglückwünscht, dass wir die Umwälzungen in der DDR mit angestoßen haben. Wenn es aber inzwischen darum geht, dass wir unsere Ansichten sagen, Vorschläge machen und Anträge stellen, wird sofort abgeschaltet. Dann wird demonstrativ weggehört, Zeitung gelesen oder man unterhält sich. Es gibt viel Selbstgefälligkeit und wohl auch Berührungsängste gegen das unbekannte Neue. Man hat irgendwie Angst, dass sich daraus Konsequenzen ergeben könnten. Natürlich müssen die 319 Abgeordneten von der CDU keine Angst vor acht Menschen haben, die niemals ein Abstimmungsergebnis im Bundestag werden beeinflussen können. Aber das Weltbild würde offensichtlich doch empfindlich belastet, wenn man zugeben müsste, dass es Impulse von uns geben könnte, über die es nachzudenken lohnt oder die sogar eine Änderung von Positionen herbeiführen könnten. Das wird systematisch verdrängt und insofern ist man uns gegenüber nicht offen. Solange sich das nicht ändert, wird es die "Ost-West-Beziehungen" belasten. Das trifft eigentlich für jeden Bürger der ehemaligen DDR zu, der jetzt seine Verwandten besucht: Es geht alles ein bisschen von oben herab. Das muss sich ändern: Nicht nur die Bürger der ehemaligen DDR müssen umlernen, auch die meisten Menschen im Westen müssen sich ändern.
Das Gespräch führte Stephan Hegger am 1. März 1991 in Bonn.
Gerd Poppe, geb. 1941 in Rostock, Physiker, ist Gründungsmitglied der Initiative Frieden und Menschenrechte. In der Umbruchphase der DDR war er Minister in der Regierung Modrow. Im März 1990 wurde er für das Bündnis 90 in die Volkskammer der DDR gewählt und im Dezember 1990 in den Bundestag.
Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 4, 1991
